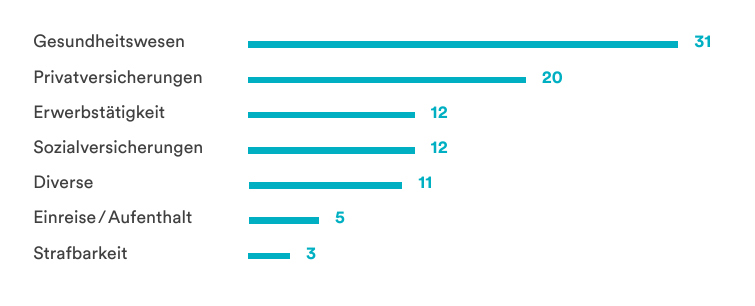14. Dezember 2017
Michèle Claudine Meyer lebt seit bald 25 Jahren mit HIV. Ein Gespräch über das gesellschaftliche Bild von HIV und Aids, Kreativität als Kraft und den Preis des Fortschritts.
Interview: Corinne Riedener
Bild: Michèle Claudine Meyer

Michèle Claudine Meyer engagiert sich als HIV-Aktivistin gegen die Diskriminierung und Kriminalisierung von Menschen mit HIV/Aids.
AHSGA: Hast du oft das Gefühl, dass du auf das HIV-Virus reduziert wirst?
Michèle Claudine Meyer: Immer wieder. Aber das verwundert mich gar nicht. Ich lebe seit bald 25 Jahren offensiv mit HIV, habe meine Lebensgeschichte «verkauft», um politische Forderungen und Statements zu transportieren und bin sehr aktiv in den Communities und in der HIV-Politik. Ich kann es verstehen, wenn man meinen Namen erstmal mit HIV assoziiert.
1994, als die Diagnose kam, warst du in einer schwierigen Phase. Kurz zuvor hast du ein Kind verloren, ein Jahr später ist dein damaliger Lebenspartner, der Vater des Kindes, an den Folgen von Aids gestorben. Trotzdem hast du dich dazu entschlossen, offen mit dem Virus umzugehen.
Diese Entscheidung hat mit drei Ebenen zu tun: Erstens ich als Mensch. Ich bin eine Person, die reflektieren muss, Dinge verarbeiten muss. Das kann ich nicht im stillen Kämmerlein tun. Ich muss meine Gedanken teilen, gemeinsam laut denken, mich spiegeln. Ich brauchte diesen Austausch, um mit der Infektion klarzukommen.
Der zweite Grund ist mein damaliger Partner, von dem ich mich ziemlich bald nach der Ansteckung getrennt habe. Sein Rachefeldzug beinhaltete unter anderem, dass er überall herumerzählte, dass ich HIV-positiv bin, sprich mich fremd geoutet hat. Es wäre also unabhängig von meiner eigenen Entscheidung sowieso herausgekommen.
Die dritte Ebene ist die politische: Das Thema HIV war mir ja nicht neu, das Thema Kriminalisierung und Diskriminierung von HIV-Infizierten war mir nicht neu, das Thema Vorurteile war nicht neu. Als mir dann noch bewusst wurde, dass Frauen mit HIV völlig unsichtbar sind in der öffentlichen Wahrnehmung, war für mich absolut klar, dass ich in die Offensive gehen muss, um an diesen Vorurteilen zu rütteln.
Klingt, als ob du schon seit jeher eine bewegte, aktivistische Seele bist. Wenn es nicht HIV gewesen wäre, hättest du vermutlich ein anderes Thema gefunden oder?
Natürlich, klar. Ich verstehe mich als politischer Mensch und wurde auch schon früh von meiner Familie politisiert. Politisch aktiv zu sein, heisst für mich, zur Gesellschaft beizutragen, zum Zusammenleben – und das will ich logischerweise mitgestalten. Das Thema HIV hat sich mir insofern angeboten, als dass es eines der Themen ist, in denen ich auch zu Hause bin.
Frauen mit HIV gab es in den 90ern keine in der öffentlichen Wahrnehmung, sagst du. Welches Bild hatte denn die Gesellschaft damals von HIV?
Man dachte, das seien alles schwule Männer und Junkies. Bei Letzteren gab es natürlich auch Frauen, aber die wurden höchstens am Rande erwähnt. Oder mit dem Wort «Flittchen» in Zusammenhang gebracht.
Wann hat sich dieses Bild geändert?
Ich glaube nicht, dass sich gross etwas verändert hat. Unterdessen assoziiert man mit HIV vielleicht noch Menschen bzw. Frauen aus den subsaharischen Gebieten … Und selbstverständlich die Sexarbeiterinnen. Selbstbestimmte Sexualität wird bei Frauen ja gerne verurteilt bzw. gegen sie verwendet, darum verbuchen leider immer noch viele die Sexarbeiterinnen in der Kategorie «Flittchen» …
Der Slogan «Aids geht uns alle etwas an» jedenfalls wurde in unserer Gesellschaft definitiv noch nicht verinnerlicht. Bis heute kommen zum Beispiel viele Ärzte nicht auf die Idee, bei Frauen mit entsprechenden Symptomen einen HIV-Test zu machen – weil sie nicht ihrem Bild von HIV entsprechen.
Wie hat dein Umfeld damals auf dein Outing reagiert?
Gemischt. Meine Haupterfahrung – im nahen Umfeld – war, dass ich als mich Outende mein Umfeld habe auffangen müssen, nicht umgekehrt. Die Angst davor, dass ich sterben oder ansteckend sein könnte, hat dazu geführt, dass ich mich um die anderen kümmern musste, sie trösten und aufklären.
Keine Diskriminierungserfahrungen gemacht?
Natürlich gab es in meinem Umfeld auch Reaktionen, die ich unter Diskriminierung hätte verbuchen können. Ich hätte sie aber auch in der Kategorie Schockreaktion und Angst vor dem Verlust eines geliebten Menschen verbuchen können … Solche Reaktionen kann man, glaube ich, nie nur auf einer Ebene verstehen – vor allem, wenn man in einer Beziehung miteinander steht. Von ausserhalb habe ich da wesentlich mehr Diskriminierung erlebt, beispielsweise als Patientin im medizinischen Bereich.
Du bist mit dem Virus fertig geworden, hast andere aufgefangen, hast den Tod deines Kindes verarbeitet und engagierst dich seit bald 25 Jahren gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz von HIV. Woher schöpfst du die Kraft für das alles?
Aus meiner Familie und meiner Wahlfamilie. Und aus der Kreativität. Ich male, ich bastle, ich schreibe. Leider fehlt mir im Moment etwas die Zeit dafür, dabei hätte ich einen Haufen irrer Projekte, die ich noch angehen oder abschliessen möchte. Weil Kreativität ja etwas ist, das man teilen soll. Kraft schöpfen kann ich auch in der Natur. Ich gehe oft mit meinen Hunden in den Wald. Und ich mag Rituale.
Du hast mit 51 Jahren noch eine Ausbildung zum Clown gemacht. Mittlerweile hast du zwei Clown-Abschlüsse – Bühnenclown und Clown-Improvisation. Läuft das für dich unter dem Label Arbeit? Oder ist das Clownen auch ein Ort der Kreativität?
Auf jeden Fall Kreativität. Als Rampensau geniesse ich es, auf der Bühne zu stehen. Das gibt mir unheimlich viel – vor allem wenn ich für die Community spielen darf.
Die Community ist dir privat sehr wichtig. Welchen Stellenwert hat sie im politischen Kampf?
Wenn es um politische Anliegen geht, fühle ich mich ausschliesslich der Community verpflichtet, niemandem sonst. Es gab auch Zeiten, in denen ich die Sache über alles gestellt habe, sprich: Die Bekämpfung der Epidemie war gleich wichtig wie die Rechte von Menschen mit HIV und Aids. Heute stehen die Menschen stehen an erster Stelle. Das Motto ist klar: Nothing about us without us.
Seit etwa zehn Jahren gibt es Medikamente, die eine Übertragung verhindern. Warum ist das noch nicht in der breiten Gesellschaft angekommen?
Es ist zum Schreien, ja! Die «Präventionisten» dürfen sich gerne eine grosse Scheibe von ihrem Misserfolg abschneiden, dass bei den Leuten bis heute Angst und Vorurteile massgeblich sind. Mit Aufklärung hat das gar nichts zu tun.
Kürzlich habe ich mit einer Mittvierzigerin über das Thema gesprochen. Sie sagte, in ihrer Jugend habe es drei grosse Angstthemen gegeben: Waldsterben, Ozon und Aids. Als Kind sei sie absolut davon überzeugt gewesen, dass sie ihren 20. Geburtstag nicht mehr erlebt.
Ein wunder Punkt, ja! Aids ist wie ein Trauma, das in den 80ern über die Gesellschaft und über die Individuen gerollt ist. Das Virus ist in die Schlafzimmer gekommen, und es betrifft die Themen Krankheit, Tod, Sex und Sucht – das Skript könnte nicht besser sein. Und die Epidemie kam ja zu einem Zeitpunkt, wo die Medizin eigentlich gerade auf einem Höhenflug war. Man hatte gegen vieles ein Mittel gefunden, die Lebenserwartung stieg kontinuierlich. Doch das HI-Virus konnten auch die «Halbgötter in Weiss» nicht kurieren.
Das hat alles auf den Kopf gestellt und eine grosse Ohnmacht ausgelöst. Dieses gesellschaftliche Trauma ist aber nie als solches behandelt worden – bis heute nicht. HIV und Aids wurde immer auf der medizinischen Ebene behandelt – als Epidemie, aber nie auf der Ebene des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der «Volksseele».
Was versuchst du heute der jüngeren Generation bzw. der Community zu vermitteln?
Know your history! Natürlich kann man sagen, dass die alten Bilder nicht mehr aktuell sind und wegmüssen. Aber diese Stereotypen sind immer noch dafür verantwortlich, dass wir stigmatisiert, kriminalisiert und diskriminiert werden. Abgesehen davon: Wir, die wir mittlerweile dank Tabletten überleben, wir verdanken das all jenen, die vor uns gestorben sind. Ohne die unzähligen Studien in den 80ern und 90ern und das daraus gewonnene Wissen gäbe es heute keine entsprechenden Medikamente.
Du hast mittlerweile auch zwei gesunde Kinder.
Ja, und diese verdanke ich unzähligen Frauen in Asien und Afrika, die sich für Studien zu Verfügung gestellt haben, weil sie sonst nicht an die HIV- und Aids-Medikamente herangekommen wären. Diese Frauen haben in der Regel einige Monate lang Medikamente bekommen, und wenn die Studie abgeschlossen war, mussten sie wieder alleine klarkommen. Ich sage das darum bewusst ganz brutal: Die Pharmaindustrie hat bei der Züchtung von Aids-Waisen in Afrika mitgeholfen.
Fortschritt hat leider immer einen Preis …
Das ist so. Darum mache ich mir immer wieder bewusst, dass ich mein Überleben anderen Menschen mit HIV und Aids verdanke. Die Forschung alleine hätte ohne die Betroffenen keinen Fortschritt erlangt. Ohne sie hätte ich damals nie diese antiretrovirale Therapie machen können, die eine Ansteckung meiner Töchter verhindert hat.
Es gibt heute wirksame Behandlungen zur Nicht-Infektiosität – wie das Medikament «PrEP», das man prophylaktisch einnehmen kann. Wo müsste man aus aktivistischer Sicht heute ansetzen, medial und politisch?
Der Kampf ist immer noch derselbe: gegen Diskriminierung und für Akzeptanz. Heute strebt man das Prinzip 90-90-90-0 an. Das heisst: 90 Prozent der Menschen sind getestet, 90 Prozent der Getesteten sind in Therapie, 90 Prozent der Therapierten sind nicht mehr infektiös – und die Null steht für die Diskriminierung.
Ich sage, es muss genau anders herum sein: Zuerst kommt Zero Diskriminierung und dann erst 90-90-90. Weil ohne «Zero» kann es kein 90-90-90 geben. Ausserdem: 90 Prozent sind verhandelbar – Zero nicht. Zero ist zuständig für den Zugang zu Information, Prävention, Behandlung und so weiter. Es gibt immer noch zu viele Menschen, die sich nicht testen lassen, weil sie im Fall des Falles nicht ausgegrenzt oder kriminalisiert werden wollen. Diesbezüglich muss sich an der gesellschaftlichen Haltung definitiv einiges ändern. Diese ist nämlich immer noch geprägt von Moralin, Unwissen, Angst und Neid.
Laufen wir heute Gefahr, dass HIV und Aids wieder unsichtbar werden?
Sicher ein Stück weit. Nur schon, weil man seinen HIV-Status seit Längerem «privatisieren» kann. Da man heutzutage nicht mehr «krank» wird, muss man es ja auch niemandem sagen, denken sich viele. Ich kann diesen Reflex verstehen, aber er hat eben auch viel mit der real existierenden Diskriminierung zu tun.
Was braucht es denn, damit das Zero fix zuoberst steht?
Es darf nicht beim Lippenbekenntnis blieben. Zero darf kein Argument sein, um Ansteckungen zu verhindern, sondern muss ernstgemeint sein und als tragende Basis verstanden werden. Das bedingt aber unter anderem den Zugang zu ärztlicher Behandlung für alle. Und zwar weltweit. Wir haben immer noch nicht gelernt, das zu teilen, was wir haben. Es gibt nach wie vor Gegenden auf dieser Welt, in denen die Versorgung mit HIV- und Aids-Medikamenten so gut wie nicht gewährleistet ist.
Das hat einerseits mit Geldern und Patentrechten zu tun, andererseits aber auch mit der Marginalisierung von Lebensentwürfen: Solange es Gegenden gibt, in denen zum Beispiel der Hass auf Homosexuelle staatlich bzw. institutionell verordnet ist, wird der Diskriminierungs-Motor weiterlaufen.
***
Michèle Claudine Meyer, 1965, lebt in Hölstein (BL). Anfang der 90er-Jahre kam sie mit einem Mann zusammen, der HIV-positiv war. Der Kinderwunsch war gross, eine künstliche Befruchtung aus finanziellen Gründen aber unmöglich. Also ging sie das Risiko einer Ansteckung ein. Im Februar 1994 verlor sie das Ungeborene. Wenig später trennte sie sich von ihrem Partner, der im Jahr darauf an Aids verstarb. Sie begab sich in Behandlung und konnte sich dank dem medizinischen Fortschritt 2002 ihren grössten Wunsch doch noch erfüllen: Heute ist sie Mutter von zwei gesunden Töchtern.
Michèle Claudine Meyer engagierte sich von Anfang an gegen die Diskriminierung und Kriminalisierung von Menschen mit HIV/Aids. Zuerst in der Schweiz, seit 1998 auch in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Deutschland. Unter anderem leitet sie regelmässig Workshops, organisiert Kongresse mit und gilt als eines der wichtigsten Aushängeschilder der Community. Sie ist Mitfrau von Positiv e.V. und im Gremium «PositHIVe Gesichter» der deutschen Aidshilfe e.V.