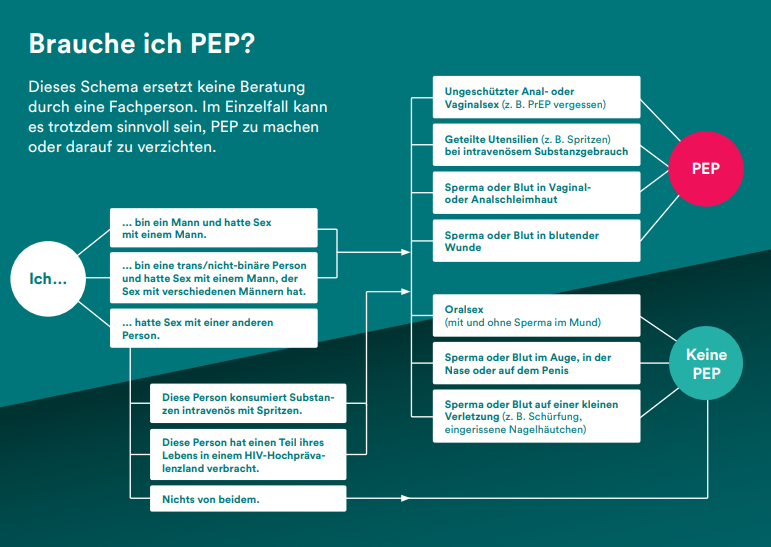18. Mai 2018
Wenige Mediziner teilen ihr Wissen so konsequent wie Pietro Vernazza. Was der St.Galler HIV-Spezialist als ethische Pflicht versteht, sorgt regelmässig für Ärger. Ein Porträt.
Text: Alan Niederer, NZZ
Bild: Christoph Ruckstuhl, NZZ

Visionär und pragmatisch: Pietro Vernazza in den Räumlichkeiten der infektiologischen Sprechstunde am Kantonsspital St. Gallen. (Bild: Christoph Ruckstuhl / NZZ)
Sein neustes Gefecht trägt er auf dem Gebiet des Stillens aus. So hat er mit Kollegen zusammen bei der Fachzeitschrift «Swiss Medical Weekly» einen Artikel eingereicht, in dem steht, dass sich mit HIV infizierte Mütter fürs Stillen entscheiden können. Pietro Vernazza weiss, dass das wieder Ärger geben wird. Denn die Aussage steht quer zu den gültigen Empfehlungen. Diese raten in reichen Ländern wie der Schweiz Frauen mit HIV vom Stillen ab. Aus Sicherheitsgründen.
Beim Stillen: Minimales
HIV-Ansteckungsrisiko
für das Kind.
«Bei optimaler Therapie ist das Ansteckungsrisiko für das Kind minimal», sagt Vernazza in seinem Büro am Kantonsspital St. Gallen. Zudem gelte es, das mehr theoretische Risiko dem nachgewiesenen Nutzen des Stillens für Mutter und Kind gegenüberzustellen. «In einer solchen Situation, wo ich als Arzt nicht weiss, welche Strategie besser ist, können beide gewählt werden», sagt Vernazza. «Das müssen wir den Frauen erklären.»
Solche Diskussionen sind typisch für den 61-jährigen Arzt. Der international anerkannte HIV-Spezialist begnügt sich nicht mit Lehrmeinungen, sondern fragt sich lieber: «Aufgrund von welchen Studiendaten empfehlen wir unseren Patienten ein bestimmtes Verhalten?» Falls die geforderten Daten nicht schon vorliegen, hilft er, sie zu beschaffen. Mit diesem rigoros wissenschaftlichen Ansatz hat er schon so manches HIV-Dogma versenkt.
Dabei deutete nichts darauf hin, dass er einmal die Aids-Medizin durchschütteln würde. Als die ersten Berichte über die mysteriöse Krankheit 1981 auftauchen, ist Pietro Vernazza Medizinstudent in Zürich und will Hausarzt werden. In der Vorlesung hört er zum ersten Mal vom «Gay-related Immunodefiency Syndrome», wie Aids damals heisst. Seinen ersten Patienten betreut er zwei Jahre später in Sursee. «Im Spital herrschte eine grosse Aufregung», erinnert sich Vernazza. Der Chefarzt habe dem Mann die Hand verweigert und die Zimmertür nur mit dem Kittel angefasst.
Die beruflichen Weichen des Jungarztes werden 1985 in St. Gallen gestellt. Der Chefarzt realisiert rasch, dass der neue Assistent nicht nur ein Händchen für die schwierigen Aids-Patienten hat, sondern auch Organisationstalent. Er ermuntert ihn, eine HIV-Sprechstunde aufzubauen. So kommt Vernazza zu seinem Thema. «Durch Zufall», wie der heutige Chefarzt der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen sagt.
«Aufgrund von welchen Studiendaten
empfehlen wir unseren Patienten
ein bestimmtes Verhalten?»
In der Anfangszeit bewältigt Vernazza die neue Sprechstunde neben der normalen Abteilungsarbeit. Die Patienten empfängt er in seinem Büro, die Blutentnahmen macht er selber. Viele können sein Engagement für die Aids-Patienten nicht verstehen. «Was kannst du da schon machen ausser Sterbebegleitung?», fragen Kollegen. Tatsächlich gibt es vor 1987 praktisch keine therapeutischen Möglichkeiten. Und dennoch gelingt es Vernazza, seinen Patienten Hoffnung zu machen. Er erinnert sich an eine Frau, die wegen ihrer Diagnose sehr niedergeschlagen war. «Nachdem sie mein Büro verlassen hatte, sah ich sie den Gang entlanghüpfen. Ich fragte mich: Was habe ich getan?»
Wahrscheinlich fühlen sich seine Patienten als Menschen erkannt, deren oft quälende Fragen nach fundierten Antworten schreien. «Die meist jungen Patienten mit ihren teilweise fremden Lebensstilen haben mich sehr interessiert», sagt Vernazza in seiner unaufgeregten, sanften Art. Für viele empfindet er auch grossen Respekt. «Weil sie trotz allen Schwierigkeiten ihr Leben meisterten.» Der Arzt wählt seine Worte sorgfältig. Präzision ist ihm auch im sprachlichen Ausdruck wichtig.
«Die meisten wollten
mit Aids-Patienten
nichts zu tun haben.»
Nicht alle teilen Vernazzas Faszination für randständige Menschen. «Die meisten wollten mit Aids-Patienten nichts zu tun haben», erinnert sich Renato Galeazzi, Vernazzas ehemaliger Chef und Förderer. Wegen ihrer Arbeit seien sie auch oft angegriffen worden, vor allem von konservativen und katholischen Kreisen. Ein Arzt habe für infizierte Personen eine Tätowierung im Genitalbereich gefordert, erzählt Galeazzi.
Seine Erfahrungen in der Anfangszeit von Aids fasst Vernazza mit dem Begriff Produkte-Feedback zusammen: Das hergestellte Produkt – in seinem Fall die medizinische Dienstleistung für randständige Menschen – beeinflusst die Position und das Ansehen des «Herstellers». Wie stark dieses Feedback sein kann, bekommt der Arzt zu spüren, als ihm das Spital eines Tages eröffnet, er dürfe nicht mehr Blut spenden. «Nur weil ich mit Aids-Patienten zu tun hatte», sagt Vernazza. «Das war völlig irrational und hat mich ausgegrenzt.»
Zu Beginn der neunziger Jahre geht er als Nationalfonds-Stipendiat für zweieinhalb Jahre in die USA. An der University of North Carolina in Chapel Hill absolviert er eine Ausbildung als Infektiologe und beginnt, wissenschaftlich zu arbeiten. Sein Forschungsthema ist die Übertragung von HIV, seine Spezialität der Erregernachweis in der Samenflüssigkeit des Mannes. Diese Arbeit wird 2008 zu seinem grössten Triumph führen: dem sogenannten «Swiss Statement», hinter dem Vernazza die treibende Kraft ist.
Das kam so: 1996 betreut er erstmals eine Frau, die sich von ihrem HIV-infizierten Mann ein Kind wünscht. Ist das überhaupt möglich? Ein Arzt in Mailand führt in solchen Fällen eine «Spermien-Wäsche» durch: Er reinigt die Samenflüssigkeit von den Viren und injiziert das «saubere» Sperma der Frau in die Vagina. Um seiner Patientin zu helfen, setzt sich Vernazza mit dem Mailänder Arzt in Verbindung und entwickelt die «Spermien-Wäsche» weiter.
«Ich bin überzeugt, dass es kein Leben
nach dem Tod gibt − deshalb möchte ich
das Leben vor dem Tod besser machen.»
In der Folge berät er 60 Paare, die aus der ganzen Schweiz zu ihm kommen. Dabei macht er eine interessante Beobachtung: Nur bei vier Männern lassen sich die Aids-Viren in der Samenflüssigkeit nachweisen. Und sie alle stehen unter keiner antiretroviralen Therapie. «Das war damals keine Seltenheit», erklärt Vernazza. «Denn die Medikamente wurden erst eingesetzt, wenn sich im Blut klare Zeichen einer Immunschwäche zeigten.»
Es ist diese Beobachtung, die den St. Galler Arzt auf eine verwegene Idee bringt: Könnte es nicht möglich sein, dass die Paare ihr Kind auf natürlichem Weg zeugen – vorausgesetzt, der HIV-positive Mann steht unter optimaler Therapie und die Frau nimmt zur Sicherheit vor dem Sex noch ein Aids-Medikament ein? Darüber spricht er mit seinen nächsten Paaren mit Kinderwunsch. Er fragt sie auch: «Wie hoch schätzen Sie das Ansteckungsrisiko ein, wenn Sie heute Abend ungeschützten Sex haben?»
Die Antworten reichen von 10 bis 90 Prozent. «Das war für mich absolut unerträglich», sagt Vernazza. «Denn wir schätzten das Risiko auf unter 0,001 Prozent.» Dieses Wissen vor den Patienten zu verschweigen, empfindet der Arzt als zutiefst unethisch. Er beginnt eine Pilotstudie, in der die Paare ihre Kinder durch ungeschützten Sex bekommen. Alles läuft nach Plan. Weder die Frauen noch die Kinder stecken sich an.
Weil das im Einklang steht mit den weltweiten Studiendaten zum Übertragungsrisiko bei Paaren, wo nur einer HIV-positiv ist, schreitet die Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen am 30. Januar 2008 zur Tat: In einem Bericht an die Ärzte schreibt sie, dass Personen mit HIV unter optimaler Therapie nicht mehr ansteckend seien. In der Aids-Welt schlug das ein wie eine Bombe. Denn allen ist klar, dass die als «Swiss Statement» apostrophierte Aussage Implikationen hat, die weit über Paare mit Kinderwunsch hinausgehen. Für Vernazza steht die Befreiung der Sexualität von falschen Ängsten im Vordergrund: «Für viele war das Statement so wichtig wie damals die Pille.»
Er habe mit Kritik gerechnet, sagt er im Rückblick. «Doch die Heftigkeit hat mich dann doch erstaunt.» Die einen bemängeln, dass es für eine so weitreichende Aussage zu wenig Studiendaten gebe. Die anderen sagen, die Information sei zwar korrekt, man dürfe sie aber nicht verbreiten, weil sie die Präventionsbemühungen schwäche. Beide Einwände erweisen sich als falsch, weshalb die meisten Kritiker inzwischen verstummt sind.
«Bei HIV geht es immer auch
um Schuld und Bestrafung.»
«Das ‹Swiss Statement› ist Vernazzas grösste Leistung», sagt Roger Staub, Mitbegründer der Aids-Hilfe Schweiz. Als langjähriger HIV-Beauftragter beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat er eng mit Vernazza zusammengearbeitet. Die öffentliche Information über etwas so Heikles wie das HIV-Übertragungsrisiko beweise den Mut und die Unabhängigkeit von Vernazza und den anderen involvierten Personen. Wie heiss die Sache war, zeigt sich laut Staub darin, dass die deutsche Gesundheitsministerin und ranghohe WHO-Beamte beim BAG interveniert und das Statement zu verhindern versucht haben.
Warum aber ist eine offene und transparente Risikokommunikation so schwierig? «Bei HIV geht es immer auch um Schuld und Bestrafung», davon ist Vernazza überzeugt. Vor allem, wenn die Krankheit schwule Männer betreffe. Der Befund passt zur Beobachtung, dass die Risikokommunikation bei anderen Gefahren einfacher gelingt. So ist schon 1985 öffentlich informiert worden, dass HIV nicht durch Küssen übertragen wird. «Die Datenlage war damals viel schlechter als beim ‹Swiss Statement›», betont der Arzt.
Mit seiner Fähigkeit der Begeisterung für neue, unkonventionelle Ideen habe sich der «visionäre Pragmatiker» nicht nur Freunde gemacht, sagt Staub, der mit Vernazza in der Eidgenössischen Kommission für Aids-Fragen sass. Als ökonomisch denkender Arzt habe er zum Beispiel auch Studien zum Nutzen von Medikamentencocktails angeregt, die günstiger seien als die Standardtherapien. «Damit ist er bei seinen stärker mit der Pharmaindustrie verbandelten Kollegen aber abgeblitzt», so Staub.
Schon früh bekommt der Arzt auch die Arroganz einzelner Universitätsspitäler zu spüren. So wird das Kantonsspital St. Gallen bei der Gründung der wichtigen Schweizer HIV-Kohortenstudie 1988 nicht als eigenständiges Aids-Zentrum zugelassen. Vernazzas Chef weiss sich jedoch zu wehren. Dank seinen Verbindungen in die Romandie wird St. Gallen als «Aussenposten» des Universitätsspitals Genf akzeptiert. Später wird die peinliche Situation bereinigt, und Vernazza wird Mitglied der wissenschaftlichen Studienkommission.
«Herr X lebt sein Sexleben offenbar
in vollen Zügen aus, während wir uns
das vielleicht verbieten.»
Sagen, was wahr und vernünftig ist – dieses Credo zieht sich wie ein roter Faden durch sein Berufsleben. Klartext spricht Vernazza auch in Bezug auf die HIV-Epidemie in der Schweiz: «Diese wird heute von Männern unterhalten, die Sex mit Männern haben.» Doch auch hier sind die Zahlen seit 2008 rückläufig, gerade was die ganz frischen Infektionen betrifft. «Das ist deshalb so wichtig», erklärt Vernazza, «weil das Ansteckungsrisiko in der Frühphase der Infektion besonders hoch ist.» Danach nehme es rasch ab – auch ohne Behandlung.
Ob es ihn gelegentlich ärgere, wenn sich Patienten «sehenden Auges» mit HIV oder einer anderen Geschlechtskrankheit ansteckten? «Die Arbeit hat mich sicher toleranter gemacht», sagt Vernazza, «auch in sexuellen Fragen.» Das Gleiche stellt er bei seinen Mitarbeitern fest. Dennoch komme es vor, dass einmal jemand in abfälligem Ton sage: «Jetzt kommt Herr X schon zum dritten Mal mit Syphilis in die Sprechstunde.» Solche Dinge bespricht er dann im Team. Denn der verheiratete Vater von drei erwachsenen Kindern ist überzeugt, dass sich hinter solchen Bemerkungen unterdrückte Wünsche verbergen können. «Herr X lebt sein Sexleben offenbar in vollen Zügen aus», erklärt Vernazza, «während wir uns das vielleicht verbieten.» Das könne zu Wut und Aggressionen führen.
Was aber treibt Vernazza an? «Sein Verständnis als Arzt», sagt Staub. «Wie er seine Verantwortung dem Patienten gegenüber sieht.» Im Gespräch mit ihm ist auch von Verpflichtung die Rede, von ethischer Notwendigkeit. Woher kommt das? «Nicht aus der Religion», sagt Vernazza. Obwohl er in jungen Jahren kurz mit dem Theologiestudium liebäugelt, tritt der Sohn eines katholischen Italieners und einer protestantischen Schweizerin mit 21 Jahren aus der katholischen Kirche aus. Die Mutter hadert, der Vater sagt nur: «Er wird schon wissen, was er tut.» Seither ist Vernazza Atheist. «Ich bin überzeugt, dass es kein Leben nach dem Tod gibt», sagt er. «Deshalb möchte ich das Leben vor dem Tod besser machen.» Für viele HIV-Patienten hat er genau das getan.
Quelle: https://www.nzz.ch/wissenschaft/ein-arzt-spricht-klartext-ld.1386146